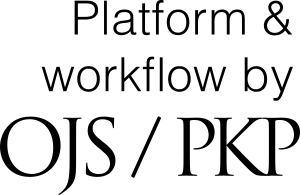Bundesverfassungsgericht: Pressemitteilung Nr. 117 vom 27.10.1998
Verfassungsbeschwerden gegen das "Bayerische Schwangerenhilfeergänzungsgesetz" sind überwiegend erfolgreich
Der Erste Senat des BVerfG hat aufgrund der mündlichen Verhandlung vom 23. Juni 1998 festgestellt, daß die Verfassungsbeschwerden gegen Regelungen des Bayerischen Schwangerenhilfeergänzungsgesetzes (BaySchwHEG) überwiegend begründet sind:
- Folgende Regelungen des BaySchwHEG verstoßen gegen das Grundrecht der Berufsfreiheit (Art. 12 Abs. 1 GG) und sind nichtig:
a) Die Regelung, wonach die jährlichen Einnahmen aus Schwangerschaftsabbrüchen ein Viertel der Gesamteinnahmen nicht übersteigen dürfen (Art. 5 Abs. 2 S. 1 BaySchwHEG); (die Entscheidung ist mit einem Stimmenverhältnis von 5:3 ergangen),
b) die Vorschrift, wonach ein Verstoß des Arztes gegen die staatliche Erlaubnispflicht strafbewehrt ist (Art. 9 Abs. 1 und 2 BaySchwHEG); (insoweit ist die Entscheidung einstimmig ergangen),
c) die Vorschrift, wonach Ärzte einen Schwangerschaftsabbruch nicht für verantwortbar halten und ihn deshalb nicht vornehmen dürfen, wenn die Frau ihre Gründe nicht dargelegt hat (Art. 18 Abs. 2 S. 1 H. 2 "Heilberufe-Kammergesetz-HKaG", Art. 11 BaySchwHEG); (Stimmenverhältnis 5:3).
Hinsichtlich dieser Vorschriften hatte das Land Bayern keine Gesetzgebungskompetenz, so daß es an einer die Freiheit der Berufsausübung beschränkenden gesetzlichen Grundlage fehlt.
- Soweit einer der Beschwerdeführer das Fehlen einer Übergangsregelung hinsichtlich der Facharztqualifikation (Art. 3 Abs. 1 S. 3 Nr. 2 H. 1 und Art. 5 Abs. 1 H. 2 des BaySchwHEG) angegriffen hat, hat der Senat ihm recht gegeben. Die Vorschriften verstoßen gegen die Berufsfreiheit und sind mit dem GG unvereinbar, soweit es an einer solchen Übergangsregelung zu Gunsten von Ärzten mit langjähriger einschlägiger Erfahrung fehlt (Stimmenverhältnis 5:3).
- Der als präventives Verbot ausgestaltete Erlaubnisvorbehalt (Art. 2 S. 1 Alt. 1, Art. 3 Abs. 1 S. 1 und Art. 8 Abs. 2 BayschwHEG) ist mit dem GG vereinbar (Stimmenverhältnis 6:2).
Hinsichtlich des Sachverhalts der bisher ergangenen Entscheidungen des Ersten Senats des BVerfG und des Wortlauts der einschlägigen Vorschriften wird auf die früheren Pressemitteilungen, insbesondere Nr. 58/97 vom 24. Juni 1997, Bezug genommen.
Im einzelnen:
I.
Der Senat führt zunächst aus, daß alle angegriffenen Vorschriften in die durch Art. 12 Abs. 1 GG geschützte Berufsfreiheit der Beschwerdeführer eingreifen. Auch die Vornahme rechtswidriger Schwangerschaftsabbrüche unterliegt diesem Grundrechtsschutz. Denn insoweit ist die Tätigkeit des Arztes notwendiger Bestandteil des (bundes-)gesetzlichen Schutzkonzepts. Es bedarf seiner Mitwirkung im Interesse der Schwangeren und ihrer Gesundheit. Zugleich ist von der Beteiligung des Arztes ein besserer Schutz für das ungeborene Leben durch eingehende ärztliche Beratung zu erwarten.
II.
1. Erlaubnisvorbehalt (Art. 2 S. 1 Alt. 1, Art. 3 Abs. 1 S. 1 und Art. 8 Abs. 2 BayschwHEG) und Facharztvorbehalt (Art. 3 Abs. 1 S. 3 Nr. 2 Halbs. 1 und Art. 5 Abs. 1 Halbs. 2 des BaySchwHEG)
Das an die Ärzte gerichtete Verbot, Abtreibungen ohne Erlaubnis vorzunehmen, und der Facharztvorbehalt regeln Bereiche der ärztlichen Berufsausübung, die der Landeskompetenz unterfallen. Der Ausübung dieser Kompetenz steht Bundesrecht nicht entgegen (a). Die Einführung eines Verbots mit Erlaubnisvorbehalt begegnet auch materiell keinen verfassungsrechtlichen Bedenken. Hingegen fehlt dem Facharztvorbehalt die verfassungsrechtlich gebotene Übergangsregelung (b).
a) Gesetzgebungskompetenz
Zu den Berufsausübungsregelungen, die nach der Kompetenzordnung des GG den Ländern zugewiesen sind, gehören auch präventive Verbote mit Erlaubnisvorbehalt.
Nach Art. 74 Abs. 1 Nr. 19 GG (Konkurrierende Gesetzgebungskompetenz des Bundes) hat der Bund die Kompetenz, die Zulassung zu ärztlichen und anderen Heilberufen gesetzlich festzulegen. Ausgestaltende Regelungen der ärztlichen Berufsausübung fallen nicht darunter. Die bundesgesetzlichen Regelungen über die Erteilung der Approbation schließen deshalb nicht aus, daß der Zugang zu einer speziellen ärztlichen Tätigkeit an weitere Erfordernisse geknüpft wird, solange nicht der Zugang zur ärztlichen Tätigkeit als Ganzes abweichend geregelt wird. Das geschieht durch die angegriffene Regelung nicht. Denn den Beschwerdeführern bleiben die Rechte aus der Approbation grundsätzlich erhalten. Im übrigen ist nicht hinreichend ersichtlich, daß der Bund selbst das Zulassungsverfahren hätte regeln wollen. Eine Kompetenz kraft Sachzusammenhangs hat er insoweit nicht in Anspruch genommen.
Dasselbe gilt für die Kompetenz der Länder, Qualifikationsanforderungen für bestimmte ärztliche Verrichtungen einzuführen. Hierzu gehört der Facharztvorbehalt des Art. 5 Abs. 1 BaySchwHEG. Auch insoweit läßt sich der bundesrechtlichen Regelung nicht entnehmen, daß mit ihr abschließend festgelegt werden sollte, daß jeder Arzt zum Schwangerschaftsabbruch befugt sei. Den Ländern ist die Kompetenz zu eigener Regelung verblieben.
b) Materielle Verfassungsmäßigkeit
Der Erlaubnis- und der Facharztvorbehalt verdeutlichen das bundesgesetzliche Schutzkonzept, indem sie die personellen, apparativen und räumlichen Voraussetzungen für die Durchführung von Schwangerschaftsabbrüchen nach § 218a Abs. 1 StGB näher umschreiben. Sie verfolgen also dieselben Gemeinwohlziele wie das Bundesrecht. Sie dienen dadurch dem Schutz von Mutter und Kind, daß nur solche Ärzte Abbrüche vornehmen dürfen, die die Gewähr dafür bieten, daß die Rechtspflichten bei der Vornahme von Schwangerschaftsabbrüchen eingehalten werden. Die Einschätzung des bayerischen Gesetzgebers, daß durch die Einführung eines vorgeschalteten behördlichen Kontrollverfahrens in Gestalt eines Erlaubnisvorbehalts die gesetzlichen Schutzziele effektiver erreicht werden als bei lediglich nachträglicher Kontrolle, ist vertretbar. Die entsprechenden Regelungen sind auch insoweit verhältnismäßig, als die betroffenen Ärzte durch die präventive Kontrolle angesichts der hohen Rechtsgüter, die auf dem Spiel stehen, nicht schwerwiegend belastet werden.
Verfassungsrechtlich zu beanstanden ist allerdings, daß die Einführung des Facharztvorbehalts nicht durch eine schonende Übergangsregelung ergänzt worden ist. Der Vertrauensschutz gebietet es, jedenfalls zugunsten derjenigen niedergelassenen Allgemeinärzte eine Übergangsregelung zu erlassen, die Schwangerschaftsabbrüche bisher in zulässiger Weise durchgeführt haben und daher in ihrer Berufsfreiheit besonders schwer betroffen sind. Ihnen muß die Möglichkeit eingeräumt werden, den Nachweis ihrer Qualifikation durch bisherige umfangreiche und beanstandungsfreie Tätigkeit zu erbringen. Der Schutz von Mutter und Leibesfrucht, dem das Facharzterfordernis dient, erfordert nicht seine übergangslose Einführung. Zudem entspricht eine solche Übergangsregelung der bundeseinheitlichen berufsrechtlichen Handhabung im Vertragsarztrecht.
III.
Für die Strafvorschriften in Art. 9 Abs. 1 und 2 BaySchwHEG (1.), für die Einnahmenquotierung (2.) und für die angegriffene Ergänzung des HKaG (3.) fehlt dem bayerischen Gesetzgeber die Gesetzgebungskompetenz.
Der Bund hat den Komplex "Schwangerschaftsabbruch" umfassend und abschließend mit dem Schwangeren- und Familienhilfeergänzungsgesetz vom 21. August 1995 geregelt. Das gilt auch für die Bereiche, in denen der Bundesgesetzgeber bewußt von einer Regelung abgesehen hat (z.B. "Einnahmenquotierung). Denn ein Gebrauchmachen von (konkurrierender) Gesetzgebungskompetenz liegt nicht nur dann vor, wenn der Bund eine Regelung getroffen hat. Auch in dem absichtsvollen Unterlassen einer Regelung kann ein Gebrauchmachen von einer Bundeszuständigkeit liegen, das dann insoweit Sperrwirkung für die Länder erzeugt.
- Strafvorschriften
Strafrechtliche Sanktionen und solche nach dem Ordnungswidrigkeitenrecht im Zusammenhang mit Schwangerschaftsabbrüchen sind in den §§ 218ff. StGB geregelt. Der Bund hat insoweit von seiner konkurrierenden Gesetzgebungsbefugnis abschließend Gebrauch gemacht und dadurch die Landeskompetenz verdrängt.
- Einnahmenquotierung
Auch insoweit sind die bundesgesetzlichen Regelungen abschließend und sperren die Gesetzgebungskompetenz eines Landes.
Der Senat legt anhand der Entwicklungsgeschichte der bundesgesetzlichen Vorschriften - insbesondere des § 13 Abs. 2 Schwangerschaftskonfliktgesetz ("Sicherstellungsauftrag") und des Art. 3 des SFHÄndG (feste Gebührensätze für Schwangerschaftsabbrüche) - dar, daß der Bund diese Fragen geprüft und es letztlich abgelehnt hat, Spezialeinrichtungen mit dem Mittel der Einnahmenquotierung zu verhindern.
Die demnach eingetretene Sperrwirkung des Bundesgesetzes kann auch nicht dadurch in Frage gestellt werden, daß Zweifel an seiner materiellen Verfassungsmäßigkeit geäußert werden. Ob das Schwangeren- und Familienhilfeänderungsgesetz des Bundes die Vorgaben aus Art. 2 Abs. 2 GG erfüllt, ist ggf. in den dafür vorgesehenen Verfahren (u.a. Normenkontrollverfahren gemäß Art. 93 Abs. 1 Nr. 2 GG, Verfassungsbeschwerde gegen das Bundesgesetz) zu prüfen. Die Länder können ein solches nicht fristgebundenes Normenkontrollverfahren beantragen. Das ist hier nicht geschehen. Die Beschwerdeführer, die durch die bundesrechtliche Regelung, um deren Sperrwirkung es geht, nicht beschwert werden, haben sie deshalb nicht angegriffen.
Ein Normenkontrollverfahren gem. Art. 93 Abs. 1 Nr. 2 GG (s.o.) kann auch nicht durch eine Inzidentprüfung im Rahmen der Beurteilung der Gesetzgebungskompetenz der Länder ersetzt werden. Die Länder könnten sich anderenfalls einer Bundesregelung entziehen, indem sie diese mit der Behauptung, sie sei verfassungswidrig, durch eine eigene Regelung ersetzten. Damit würden sowohl die notwendige Abgrenzung und Balance zwischen den einzelnen Verfahrensarten als auch die Rechtssicherheit gefährdet, die darauf gründet, daß verkündete Gesetze beachtet werden.
Etwas anderes ergibt sich auch nicht aus dem Gesichtspunkt einer "offensichtlichen Verfassungswidrigkeit" der Bundesregelung. Eine solche setzte u.a. voraus, daß an der Verfassungswidrigkeit vernünftigerweise keine Zweifel möglich sind. Davon kann hier keine Rede sein. Zwar ist der Bundesgesetzgeber Vorkehrungen gegen das Entstehen von Spezialeinrichtungen, wie sie das BVerfG in seinem Urteil vom 28. Mai 1993 erwartet hatte, nach Erwägung der in dem Urteil beispielhaft angeführten Möglichkeit nicht nähergetreten. Darin liegt aber kein offensichtlicher Verfassungsverstoß.
Die Feststellung des BVerfG, daß eine gesetzliche Regelung mit dem GG unvereinbar oder nichtig sei, hat allerdings Gesetzeskraft und bindet alle staatlichen Organe. Eine solche Entscheidung bedeutet jedoch kein absolutes Verbot, eine beanstandete Norm im Gesetzgebungsverfahren zu wiederholen, sofern sich z.B. die Rahmenbedingungen geändert haben. Hier hat der Bundesgesetzgeber ein novelliertes Schutzkonzept für das ungeborene Leben auf der Grundlage des BVerfG im Urteil von 1993 in Kraft gesetzt. Dabei kann die Einschätzung von Gefahren und die Beurteilung wirksamer Mittel zu ihrer Abwehr dem Gesetzgeber grundsätzlich vom BVerfG nicht vorgegeben werden. Dasselbe gilt für die Einschätzung der Wirksamkeit einzelner Bestandteile des Schutzkonzepts im Rahmen der Gesamtregelung.
- Offenbarungspflicht der Schwangeren bei der ärztlichen Beratung
Auch insoweit hat das Bundesrecht die Anforderungen abschließend festgelegt. Nach § 218c Abs. 1 Nr. 1 StGB ist der Frau Gelegenheit zu geben, die Gründe für ihr Verlangen nach Abbruch der Schwangerschaft darzulegen. Ihre Gesprächs- und Mitwirkungsbereitschaft darf nicht erzwungen werden.
Die bayerische Regelung, wonach Ärzte ihre Mitwirkung am Schwangerschaftsabbruch abzulehnen haben, wenn die Frau die Beweggründe für ihr Verlangen nach Abbruch nicht dargelegt hat, ist nichtig, weil für ergänzendes Landesrecht kein Raum ist.
Der Senat führt aus, daß sich der Bundesgesetzgeber bei seiner Regelung zum Ziel gesetzt hat, übereinstimmendes Recht für die Konfliktberatung (§ 219 StGB i.V.m. § 5 SchKG) und für die nachfolgende Beratung beim Arzt (§ 218c StGB) zu schaffen; davon hat er sich ein Maximum an Lebensschutz erhofft, indem Verständnis, Ermutigung und offenes Gespräch die Verantwortungsbereitschaft der Frau stärken. Zwar wird von der schwangeren Frau erwartet, daß sie sowohl in der Beratungsstelle als auch gegenüber dem Arzt ihre Gründe mitteilt, derentwegen sie einen Abbruch erwägt; der Beratungscharakter schließt es nach Einschätzung des Bundesgesetzgebers aber aus, die Gesprächs- und Mitwirkungsbereitschaft zu erzwingen. Deshalb ist für ergänzendes Landesrecht insoweit kein Raum. Die bundesrechtlichen Vorschriften umreißen in diesem Punkt zugleich die Grenzen ärztlichen Berufsrechts.
Die Verfassungswidrigkeit der bayerischen Regelung bedeutet im übrigen nicht, daß Ärzte, die einen Schwangerschaftsabbruch deshalb nicht für verantwortbar halten, weil die Frau ihnen keine Gründe mitgeteilt hat, zur Abtreibung verpflichtet wären. Jeder Arzt kann und muß einen von ihm nicht für verantwortbar gehaltenen Abbruch ohnedies verweigern (§ 12 SchKG). Die bundesgesetzliche Sperrwirkung behindert also weder die individuell begründete Haltung des einzelnen Arztes noch die Entwicklung berufsethischer Standards.
IV.
Abweichende Meinungen
- Der Vizepräsident Papier und die Richterinnen Graßhof und Haas haben dem Urteil eine abweichende Meinung beigefügt. Sie sind der Auffassung, daß der bayerische Gesetzgeber die angegriffenen Vorschriften - mit Ausnahme der strafrechtlichen Sanktionen (Art. 9 Abs. 1 und 2 BayschwHEG) - kompetenzgemäß erlassen hat. Die Senatsmehrheit habe nach ihren eigenen Maßstäben nur dann davon ausgehen können, daß der Bundesgesetzgeber die Komplexe "Einnahmenquotierung" und "ärztliche Beratung der abbruchwilligen Frau" durch Übergriff in die ausschließliche Gesetzgebungszuständigkeit der Länder kompetenzgemäß geregelt habe, wenn dies für die Länder erkennbar gewesen sei und wenn der Bundesgesetzgeber es darüber hinaus als unerläßlich zur Verwirklichung seines Schutzkonzepts der Beratungsregelung angesehen habe, daß die in Rede stehenden Komplexe bei Regelung des Abtreibungsstrafrechts mit normiert werden. Diese beiden Voraussetzungen habe die Senatsmehrheit nicht nachvollziehbar feststellen können.
Wortlaut und Entstehungsgeschichte der bundesrechtlichen Vorschriften des § 13 SchKG und des § 218c StGB, in die die Senatsmehrheit die bundesrechtliche Regelung zum Ausschluß einer Verhinderung von Spezialkliniken durch Quotenregelung und zum ärztlichen Berufsrecht hineinlese, wiesen im Gegenteil darauf hin, daß diese Komplexe durch Bundesrecht nicht geregelt seien. So sei der Bundesgesetzgeber unter anderem davon ausgegangen, er habe für entsprechende Regelungen keine Kompetenz.
Auch stelle es das Schutzkonzept einer Beratungsregelung, welches das Bundesverfassungsgericht in seiner Entscheidung vom 28. Mai 1993 gebilligt habe und der Bundesgesetzgeber habe umsetzen wollen, geradezu auf den Kopf, wenn die Senatsmehrheit dem Bundesgesetzgeber die Einschätzung unterstelle, er habe es zur Verwirklichung des Schutzkonzepts als unerläßlich ansehen können, den Ländern zu verbieten, Spezialkliniken entgegenzuwirken und ärztliches Berufsrecht, das sich im ärztlichen Selbstverständnis - auch zum Schutz ungeborenen Lebens - herausgebildet habe, in seinen Anforderungen zurückzunehmen.
Die Senatsmehrheit grenze auch die im GG vorgesehene konkurrierende Gesetzgebungszuständigkeit nicht hinreichend gegen die ungeschriebene Ausnahmekompetenz kraft Sachzusammenhangs ab. Nur unter Rückgriff auf Rechtsprechung zur konkurrierenden Gesetzgebungszuständigkeit lasse die Senatsmehrheit es zu, daß auch im Wege einer Kompetenz kraft Sachzusammenhangs durch "absichtsvollen Regelungsverzicht" in den Kompetenzbereich der Länder übergegriffen werden könne. Diese Ausnahmekompetenz erlaube es aber nur, daß von ihr punktuell durch positive Teilregelungen des fremden Sachbereichs Gebrauch gemacht werde. Auch könnten die Länder aus ihrer ausschließlichen Gesetzgebungskompetenz nur durch ein materiell verfassungsgemäßes Bundesgesetz verdrängt werden. Die auf die konkurrierende Gesetzgebungszuständigkeit bezogene Argumentation der Senatsmehrheit sei daher auf den vorliegenden Fall nicht übertragbar.
Jedenfalls habe die Senatsmehrheit aber auch auf der Grundlage ihrer Auffassung einem Bundesgesetz, das evident verfassungswidrig sei, die kompetenzverdrängende Kraft versagen müssen. Um eine solche Fallgestaltung habe es sich hier gehandelt. Hätte der Bundesgesetzgeber die in die Vorschriften des § 13 SchKG und § 218c StGB von der Senatsmehrheit hineingelesenen Regelungen getroffen, so würde es sich förmlich aufdrängen, daß sie die Mindestvoraussetzungen eines Schutzes des ungeborenen Lebens, der dem Gesetzgeber von der Verfassung zu beachten aufgegeben ist, nicht mehr wahren. Sie verdrängten die Länder aus der auch ihnen obliegenden Aufgabe, ungeborenes Leben im Rahmen ihres Kompetenzbereichs zu schützen. An die Stelle der Regelungsmöglichkeiten der Länder träten bundesrechtliche Vorschriften, die Schutzmaßnahmen untersagen oder nivellieren.
Die dissentierenden Richter sind darüber hinaus der Auffassung, daß die Senatsmehrheit die Grenzen der Ausnahmekompetenz kraft Sachzusammenhangs weiter ziehe, als das Bundesverfassungsgericht sie bisher festgelegt habe. Da der Bundesgesetzgeber keine umfassende Kompetenz zur Regelung des Abtreibungsrechts habe, könne er das Schutzkonzept einer Beratungsregelung - unter Inanspruchnahme seiner Strafrechtskompetenz - nur insoweit durch Übergriff in die ausschließliche Kompetenz der Länder verwirklichen, als er dabei Tatbestände der Strafbarkeit oder Straffreiheit regele. Das sei etwa der Fall, soweit der Bundesgesetzgeber festlege, welchen Inhalt eine Beratung haben müsse, um den Tatbestand der Straffreiheit zu verwirklichen. Hingegen sei die Strafbarkeit oder Straffreiheit von Frauen und Ärzten unabhängig davon geregelt, ob der jeweilige Arzt auf Abtreibungen spezialisiert sei und welchen Inhalt das ärztliche Berufsrecht habe.
Schließlich sind die dissentierenden Richter der Auffassung, daß es bei dem Facharztvorbehalt einer unbefristeten Übergangsregelung von Verfassungs wegen nicht bedürfe. In der mündlichen Verhandlung habe die bayerische Staatsregierung darauf hingewiesen, daß es nach ihrer Erkenntnis und der des bayerischen Gesetzgebers außer einem der Beschwerdeführer keine Allgemeinmediziner mit größerer Abtreibungspraxis gebe. Bei dieser Sachlage habe der bayerische Gesetzgeber vom Erlaß einer abstrakten Übergangsregelung für Allgemeinmediziner absehen dürfen. Eine konkret auf den einen Beschwerdeführer bezogene Übergangsregelung sei aus mehreren Gründen von Verfassungs wegen nicht zu fordern gewesen.
- Eine weitere abweichende Meinung stammt von dem Richter Kühling und der Richterin Jaeger.
Sie halten die Einführung des präventiven Verbots mit Erlaubnisvorbehalt (Art. 3 Abs. 1 BaySchwHEG) insgesamt für verfassungswidrig. Dem Freistaat Bayern fehle hierfür die Gesetzgebungskompetenz, weil der Bund von seiner Kompetenz aus Art. 74 Abs. 1 Nr. 19 GG abschließend Gebrauch gemacht habe. Verbote in dieser Form dienten nicht dazu, unerwünschte Handlungen zu unterbinden; in Verbindung mit dem Erlaubnisvorbehalt hätten die Verbote vielmehr den Zweck, die für diese Tätigkeit geeigneten und bereiten Personen aufgrund einer Qualifikationsprüfung zu bestimmen. Das Bayerische Landesrecht sehe damit eine ergänzende spezialisierte Approbation für Schwangerschaftsabbrüche vor.
Außerdem sei das präventive Verbot mit Erlaubnisvorbehalt unverhältnismäßig und damit auch materiell verfassungswidrig.
Die Regelung bürde den Ärzten eine besondere Last auf: Sie würden gezwungen, staatlichen Behörden ihre Bereitschaft zu bekunden, Schwangerschaftsabbrüche durchzuführen. Das sei kein wertneutraler Akt, weil Schwangerschaftsabbrüche in weiten Teilen der Bevölkerung aus ethischen und religiösen Gründen abgelehnt würden. Der Arzt laufe daher Gefahr, in rufschädigender Weise mit der mißbilligten Handlung identifiziert zu werden. Belastend seien auch die besonderen Kontrollen durch die mit weitgehenden Befugnissen ausgestatteten Behörden. Diese Belastungen seien unverhältnismäßig, weil der Erlaubnisvorbehalt den Schutz der hohen Rechtsgüter, die auf dem Spiel stünden, nicht verstärke. Schwangerschaftsabbrüche seien weder schwieriger noch risikoreicher als andere ambulante Operationen, die die betreffenden Ärzte durchführten. An deren Rechtstreue und Zuverlässigkeit würden deshalb generell hohe Anforderungen gestellt. Sorgfältige Beratung und Aufklärung vor allen operativen Eingriffen gehörten zu ihren Pflichten. Sie unterlägen insofern einer wirksamen staatlichen und standesrechtlichen Kontrolle. Daß diese nicht ausreiche, um auch die Einhaltung der Spezialvorschriften für Schwangerschaftsabbrüche zu gewährleisten, sei nicht erkennbar.
Die Einschätzung, daß es sich insgesamt um schwerwiegende Beeinträchtigungen der ärztlichen Berufsfreiheit handele, werde durch den Umstand bestätigt, daß nur insgesamt 10% der bayerischen Frauenärzte sich bereitgefunden hätten, eine Erlaubnis zu beantragen, von denen rund die Hälfte nicht einmal gestatte, daß ihre Bereitschaft den Beratungsstellen oder nachsuchenden Frauen offengelegt werde. Nicht zuletzt darauf dürfte zurückzuführen sein, daß in Bayern ein hoher Anteil von Schwangerschaftsabbrüchen auf wenige spezialisierte Praxen entfiele.
Entscheidung vom 27.10.1998, 1 BvR 2306/96