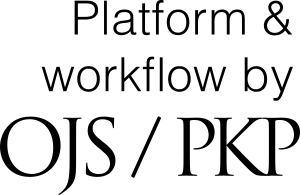Bundesverfassungsgericht: Pressemitteilung Nr. 4 vom 22.01.2015
Staatliche Anerkennung der Mitgliedschaft in einer Religionsgemeinschaft abhängig vom nach außen erkennbaren Willen des Betroffenen
Mit heute veröffentlichtem Beschluss hat die 1. Kammer des Zweiten Senats des Bundesverfassungsgerichts der Verfassungsbeschwerde einer jüdischen Gemeinde gegen ein Urteil des Bundesverwaltungsgerichts stattgegeben. Die Kläger des Ausgangsverfahrens hatten dort erfolgreich geltend gemacht, ihre Mitgliedschaft in der Beschwerdeführerin sei durch den Staat nicht anzuerkennen. Das Bundesverwaltungsgericht ist zwar von zutreffenden verfassungsrechtlichen Maßstäben bei der Abgrenzung zwischen dem Selbstbestimmungsrecht der Religionsgemeinschaft (Art. 140 GG in Verbindung mit Art. 137 Abs. 3 WRV) und der negativen Religionsfreiheit des Einzelnen (Art. 4 GG) ausgegangen. Es hat jedoch Bedeutung und Tragweite des Selbstbestimmungsrechts verkannt, indem es überzogene Anforderungen an den erkennbaren Willen, der Beschwerdeführerin anzugehören, gestellt hat. Das Urteil des Bundesverwaltungsgerichts hat die Kammer daher aufgehoben und das Verfahren zur erneuten Entscheidung zurückverwiesen.
Wesentliche Erwägungen der Kammer:
Die angegriffene Entscheidung des Bundesverwaltungsgerichts verletzt die Beschwerdeführerin in ihrem Recht aus Art. 4 Abs. 1 und Abs. 2 in Verbindung mit Art. 140 GG und Art. 137 Abs. 3 WRV.
1. Art. 140 GG in Verbindung mit Art. 137 Abs. 3 WRV garantiert den Religionsgesellschaften die Freiheit, ihre Angelegenheiten selbständig innerhalb der Schranken des für alle geltenden Gesetzes zu ordnen und zu verwalten. Eigene Angelegenheiten in diesem Sinne sind auch die Rechte und Pflichten der Mitglieder der einzelnen Religionsgemeinschaft, insbesondere Bestimmungen, die den Ein- und Austritt und die mitgliedschaftliche Stellung regeln. Die Pflicht des Staates, eine religionsgemeinschaftliche Regelung für den weltlichen Rechtsbereich anzuerkennen, besteht jedoch nicht grenzenlos. Als Schranke des für alle geltenden Gesetzes kommt das Grundrecht der negativen Glaubens- und Bekenntnisfreiheit (Art. 4 GG) eines als Mitglied Herangezogenen in Betracht. Abzustellen ist auf den nach einem objektivierten Empfängerhorizont erkennbar gewordenen Willen des Betroffenen. Die Eingliederung in eine Religionsgemeinschaft ist im staatsrechtlichen Bereich dann anerkennungsfähig, wenn sie durch eine positive - wenn auch möglicherweise nur konkludente - Erklärung des Betroffenen legitimiert ist; eine darüber hinausgehende förmliche Beitrittserklärung ist nicht erforderlich. Der Wille, einer Religionsgemeinschaft angehören zu wollen, kann in vielfältiger Weise, nicht nur gegenüber der Religionsgemeinschaft selbst, zum Ausdruck gebracht werden.
2. Gemessen an diesen verfassungsrechtlichen Maßstäben hat das Bundesverwaltungsgericht in der angefochtenen Entscheidung die Bedeutung und Tragweite von Art. 140 GG in Verbindung mit Art. 137 Abs. 3 WRV verkannt.
a) Das Bundesverwaltungsgericht geht in seiner Entscheidung zunächst zutreffend davon aus, dass sich die Frage der Mitgliedschaft nach dem innerreligionsgemeinschaftlichen Recht richtet, wenn das staatliche Recht an die Zugehörigkeit zu einer Religionsgemeinschaft anknüpft. Auch soweit es Grenzen des Selbstbestimmungsrechts der Religionsgemeinschaften in den allgemeinen Gesetzen und dort insbesondere in der negativen Bekenntnisfreiheit sieht, geht es vom zutreffenden verfassungsrechtlichen Maßstab aus.
Soweit das Bundesverwaltungsgericht darauf abstellt, ob eine Willensbekundung festgestellt werden könne, die den Schluss auf eine vom Willen des Betroffenen getragene Zuordnung zu einer Religionsgemeinschaft erlaube, ist dies nicht zu beanstanden. Dem verfassungsrechtlich garantierten Schutz der Glaubens- und Bekenntnisfreiheit wird dadurch hinreichend Rechnung getragen. Wenn Rechte im konkreten Fall in der konkreten Person des Dritten durch die Mitgliedschaftsregelung nicht verletzt werden, bedarf das Selbstbestimmungsrecht der Religionsgemeinschaften keiner Einschränkung durch die allgemeinen Gesetze. Eine mit Art. 4 Abs. 1 GG nicht zu vereinbarende Zwangsmitgliedschaft liegt in diesem Fall nicht vor. Das Selbstbestimmungsrecht der Religionsgemeinschaften verpflichtet den Staat dann zur Anerkennung ihrer Mitgliedschaftsordnung, auch soweit sie von den staatlichen Regeln für Zusammenschlüsse abweicht.
Auch soweit das Bundesverwaltungsgericht fordert, die Willensbekundung müsse sich auf die Mitgliedschaft in der konkreten rechtlich verfassten Religionsgemeinschaft beziehen, ist hiergegen von Verfassungs wegen nichts zu erinnern. Nur die jeweiligen verfassten Religionsgemeinschaften sind - ungeachtet ihrer rechtlichen Organisationsform - Träger des in Art. 140 GG in Verbindung mit Art. 137 Abs. 3 WRV gewährleisteten Selbstbestimmungsrechts.
b) Ob das Bundesverwaltungsgericht mit seiner Auffassung, einer sich allein auf Wohnsitz und Abstammung stützenden Mitgliedschaftsregelung sei die Anerkennung im staatlichen Recht zu versagen, die Beschwerdeführerin in ihrem Selbstbestimmungsrecht verletzt hat, kann vorliegend offen bleiben. Denn jedenfalls verkennt es Reichweite und Grenzen des Selbstbestimmungsrechts der Religionsgemeinschaften, indem es davon ausgeht, angesichts der konkreten Umstände des Einzelfalles sei keine ausreichende Willensbekundung der Kläger des Ausgangsverfahrens erkennbar, der Beschwerdeführerin angehören zu wollen.
aa) Aus den Angaben der Kläger gegenüber der Meldebehörde lässt sich - erst recht in einer Gesamtschau mit den weiteren Umständen des Einzelfalles - aus Sicht eines objektiven Dritten der nach außen objektiv erklärte Wille der Kläger entnehmen, der Beschwerdeführerin angehören zu wollen. Angaben gegenüber Meldebehörden sind als voluntative Grundlage zur Begründung eines Mitgliedschaftsverhältnisses in einer Religionsgemeinschaft geeignet; insbesondere ist unschädlich, dass die Religionsgemeinschaft lediglich mittelbarer Adressat der meldebehördlichen Angabe ist. Zwar haben die Kläger keine Abkürzung verwendet, die eine der als Körperschaften des öffentlichen Rechts anerkannten Religionsgemeinschaften zweifelsfrei identifiziert. Jedoch wird aus der Angabe „mosaisch“ nach außen hinreichend erkennbar, dass die Kläger der Beschwerdeführerin angehören wollten. Insbesondere lässt diese Angabe für einen objektiven Dritten nicht erkennbar werden, dass die Kläger einer bestimmten liberalen Richtung des Judentums angehören wollten. Vielmehr kann der Begriff im vorliegenden Zusammenhang nach außen erkennbar nur als Synonym dafür verstanden werden, „jüdischer“ Religionszugehörigkeit zu sein.
bb) Wenn das Bundesverwaltungsgericht sich angesichts einer von ihm angenommenen Tendenz zur Pluralisierung und Rekonfessionalisierung des Judentums daran gehindert sieht, aus der Angabe einer „mosaischen“ Religionszugehörigkeit auf die Zuordnung zur konkreten jüdischen Gemeinde zu schließen, verkennt es, dass es sich bei den von den Klägern angeführten unterschiedlichen Strömungen jedenfalls um Strömungen innerhalb des Judentums handelt. Dem Staat ist es aufgrund seiner Pflicht zur religiös-weltanschaulichen Neutralität nicht gestattet, Glauben und Lehre einer Religionsgemeinschaft als solche zu bewerten. Versteht sich eine Religionsgemeinschaft als dem jüdischen Glauben verpflichtet, ohne eine weitere Differenzierung in eine bestimmte liberale oder orthodoxe Richtung vorzunehmen, so ist es dem Staat mangels Einsicht und geeigneter Kriterien verwehrt, diese Beurteilung in Zweifel zu ziehen. Auch der einzelne Gläubige kann eine derartige Bewertung nicht in Frage stellen. Die verfasste Religionsgemeinschaft bestimmt, wie sie Glaube, Lehre und Kultus versteht. Dem kann der Einzelne als Mitglied dieser Religionsgemeinschaft folgen oder, wenn er die Auffassungen der verfassten Religionsgemeinschaft nicht mehr teilt, dies durch Austritt deutlich machen.
cc) Unabhängig hiervon kann vorliegend jedenfalls aus der Gesamtschau der Begleitumstände die Mitgliedschaft in der konkreten Gemeinde bejaht werden. Die Beschwerdeführerin ist die einzige jüdische Gemeinde in F.; es entspricht daher lebensnaher Auslegung, dass der Anmeldende im Zweifel Mitglied dieser Gemeinde werden möchte. Ein Vorbehalt, nur dann Mitglied in einer Religionsgemeinschaft werden zu wollen, wenn diese einer bestimmten - sei es orthodoxen, sei es liberalen - Ausrichtung folgt, kann der Erklärung der Kläger schon von ihrer Wortbedeutung nicht entnommen werden. Zudem muss beachtet werden, dass sich die Beschwerdeführerin nach ihrem über Art. 140 GG in Verbindung mit Art. 137 Abs. 3 WRV geschützten Selbstverständnis vorliegend als Einheitsgemeinde versteht, deren Ziel es gerade ist, unterschiedliche Strömungen des Judentums innerhalb einer Gemeinde zu vereinen. Die von den Klägern vorgenommene Unterscheidung zwischen orthodox und liberal geprägten jüdischen Gemeinden ist der Satzung der Beschwerdeführerin nicht zu entnehmen.
Dieses Verständnis der Angaben der Kläger des Ausgangsverfahrens drängt sich im vorliegenden Fall umso mehr auf, da zumindest die Klägerin bereits vor ihrem Wegzug nach Frankreich - ebenso wie ihre in der dortigen Gemeinde aktiven Eltern - Mitglied der Beschwerdeführerin war. Auch vor ihrem Wegzug nach Frankreich hatte sie von der Möglichkeit, den Austritt aus der Beklagten zu erklären, keinen Gebrauch gemacht.
c) Ob die Beschwerdeführerin durch die Ausführungen des Bundesverwaltungsgerichts zum Parochialrecht in ihren Rechten verletzt ist, kann danach ebenso offen gelassen werden, wie die von der Beschwerdeführerin geltend gemachte Verletzung weiterer Rechte.
Beschluss vom 17. Dezember 2014
2 BvR 278/11