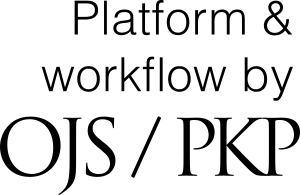Landrecht und Konkordat. Ein Streifzug durch die Genese des kurzlebigen Konkordats von Tønsberg (1277) und seinen langwierigen Vor- und Nachwirkungen.
DOI:
https://doi.org/10.5282/nomokanon/280Schlagworte:
Konkordat von Tønsberg , Landrecht, NorwegenAbstract
Im Jahr 2024 wird in Norwegen das 750-jährige Jubiläum der Verabschiedung des Landrechtes von 1274 begangen, das auf die Gesetzgebungstätigkeit König Magnus VI. "Lagabøte" zurückgeht. In seiner Regierungszeit wurden bereits bestehende Gesetzessammlungen zu einem einheitlichen Recht reformiert und ein Konkordat zwischen dem König und dem Erzbischof von Nidaros geschlossen. Das Konkordat von Tønsberg (1277) markierte eine bedeutende Vereinbarung zwischen der norwegischen Krone und der Kirche, dessen Gültigkeit nach dem Tod König Magnus' infrage gestellt und drei Jahre später aufgehoben wurde. Trotz des Bruchs blieb es ein symbolisches Fundament für die Rechte der Kirche und spielte bis in das 16. Jahrhundert hinein eine Rolle in der rechtlichen und politischen Auseinandersetzung zwischen Krone und Kirche. Das Konkordat von Tønsberg prägte die kirchlich-staatlichen Beziehungen über Jahrhunderte hinweg, sowohl als Streitpunkt als auch als historischer Bezugspunkt.
In 2024, Norway will celebrate the 750th anniversary of the adoption of the Land Law of 1274, which dates back to the legislative activities of King Magnus VI ‘Lagabøte’. During his reign, existing laws were reformed, and a concordat was concluded. The Concordat of Tønsberg (1277) marked an important agreement between the Norwegian crown and the church, the validity of which was called into question after King Magnus' death and cancelled three years later. Despite the breach, it remained a symbolic foundation for the rights of the Church and played a role in the legal and political dispute between the Crown and the Church well into the 16th century. The Tønsberg Concordat characterised church-state relations for centuries, both as a point of contention and as a historical point of reference.